Aktuell läuft bei mir das 2019 erschienene Album der Band Red Hearse rauf und runter, vor allem der Song Blessin’ Me. Die Band liest sich auf Wikipedia eher wie ein Side Project des Songwriters und Producers Jack Antonoff, der – sind wir mal ehrlich – ja auch in der restlichen Musik, die ich so höre, seine Finger im Spiel hat und hatte. Je mehr man über ihn liest, desto mehr will man es eigentlich nicht gelesen haben: ehemaliger Partner und Mitberwohner von Lena Dunham, Exfreund von Scarlett Johansson, Songwriting und Producing für Lorde, Tylor Swift, Lana Del Ray … Stop it already. Da ist mir das Side-Project-Framing von Red Hearse, zusammen mit Sam Dew und Sounwave, doch etwas lieber – und hörenswert ist es sowieso! Zum Beispiel auf Spotify oder Apple Music.
Arbeit und Struktur
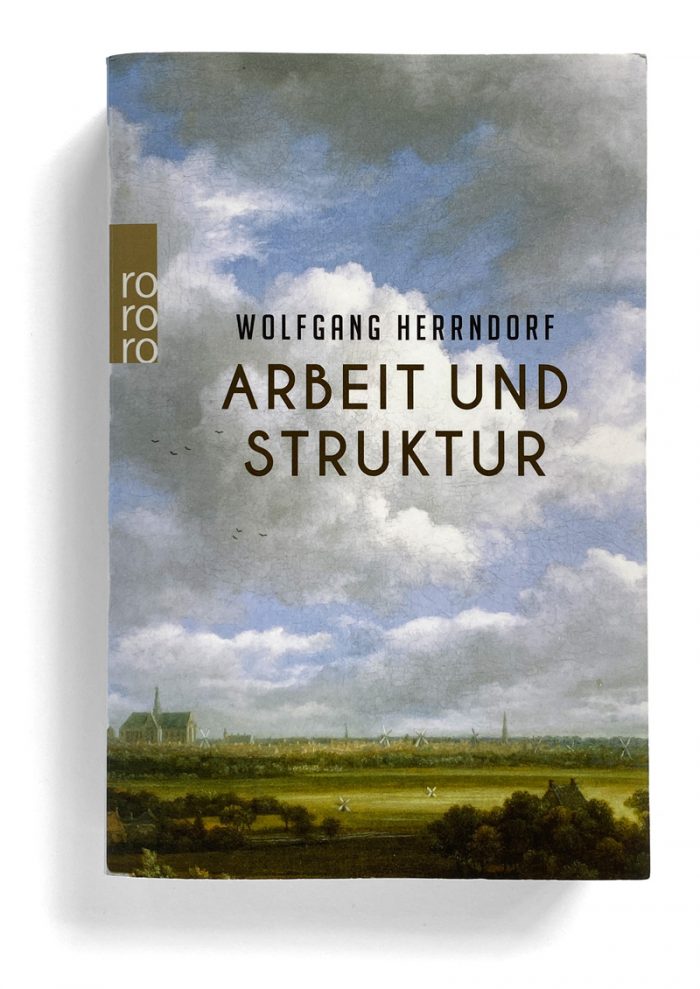
Viel zu spät (8 Jahre, um genau zu sein) lese ich Wolfgang Herrndorfs postum veröffentlichtes Tagebuch-Blog »Arbeit und Struktur«. Von dem Autor, der 2010 eine Glioblastom-Diagnose bekam und der sich deshalb 2013 selbstbestimmt das Leben nahm, hatte ich bisher nur »Tschick« gelesen. Das fand ich, damals, ganz okay. Ich wusste aber, weil ich es immer mal wieder irgendwo aufschnappte, dass »Arbeit und Struktur« als sein treffenderes Werk gehandelt wird. Und es hat mich absolut fertig gemacht; ich fand es großartig.
Das Format: Tagebucheinträge, ursprünglich als Blog geschrieben; vielleicht eins meiner liebsten Textformate. Die Nüchternheit des Autors haben mich wütend gemacht; sein Blick für Details neidisch; der Fokus, mit dem er die Welt beschreibt ansteckend. Habe danach reflexhaft selbst komplett trocken, analytisch und in einer übertriebenen Fülle wieder Tagebuch geschrieben.
Hier sind einige Annotationen aus meiner Ausgabe:
Neben Passig und Hubrich ist Cornelius derjenige, bei dem es mich am meisten schmerzt, nicht zu wissen, wo er in zehn Jahren sein wird. Dieses unfassbare Potenzial, das nirgends hinsteuert. Vielleicht sitzt er dann bei Alexander Kluge. Oder versackt in Princeton. Oder redet weiter im Prassnik Leute an die Wand. (S. 45)
Das Wissen, dass das Leben vermutlich nicht mehr länger als ein paar Monate oder Jahre dauern wird, vermisst die Dinge neu. Vor allem misst man sich wohl nicht mehr so sehr mit der Welt. Wo werden meine Freunde in zehn Jahren sein?
Passig kommt zum Korrekturlesen für den fertigen Roman vorbei. (S. 64)
Immer wieder schreibt Herrndorf davon, wie er und seine Freunde durch die Arbeit (vor allem an Texten) verbunden sind. Das ist für mich die schönste Vorstellung: Wie Freunde vorbei kommen, um gemeinsam zu arbeiten, womöglich sogar bei der eigenen Arbeit helfen. Die eigenen Texte gegenlesen. Das ist mir zuletzt zu Unizeiten vor zehn Jahren passiert, und ich vermisse es.
Die Bewegung tut dem Körper gut, trotzdem heute wieder den ganzen Tag in Gedanken. Dann ist es nur eine Armlänge bis zum Wahnsinn und noch zwei Fingerbreit zum Nichts. Ich muss nur die Hand ausstrecken. Es wundert mich, dass es den anderen nicht so geht. (S. 74)
Ein Wahnsinnssatz, den man vielleicht ein bisschen nachfühlen kann, wenn man es kennt, sich in Gedankenstrudeln zu verlieren.
Der einfachste Weg zu gutem Stil: Sich vorher überlegen, was man sagen will. Dann sagt man es einfach, und wenn es einem dann zu einfach erscheint, kann das zwei Gründe haben. Erstens, die Sprache ist nicht aufgeladen genug von ihrem Gegenstand, oder der Gedanke ist so einfach, dass er einen selbst nicht interessiert. In diesem Fall löscht man ihn. (S. 284)
Gilt eigentlich für alles, was man macht und veröffentlichen will. Ich wünschte, dieses Mantra würden die Menschen auf Twitter wieder mehr verinnerlichen.
Merkwürdig und schön sind vor allem die Gedichte, die Herrndorf hier und da einstreut (z.B. S. 420):
Niemand kommt an mich heran
bis an die Stunde meines Todes.
Und auch dann wird niemand kommen.
Nichts wird kommen, und es ist in meiner Hand.
Wolfgang Herrndorf: Arbeit und Struktur, Rowohlt 2013
Der Knacks
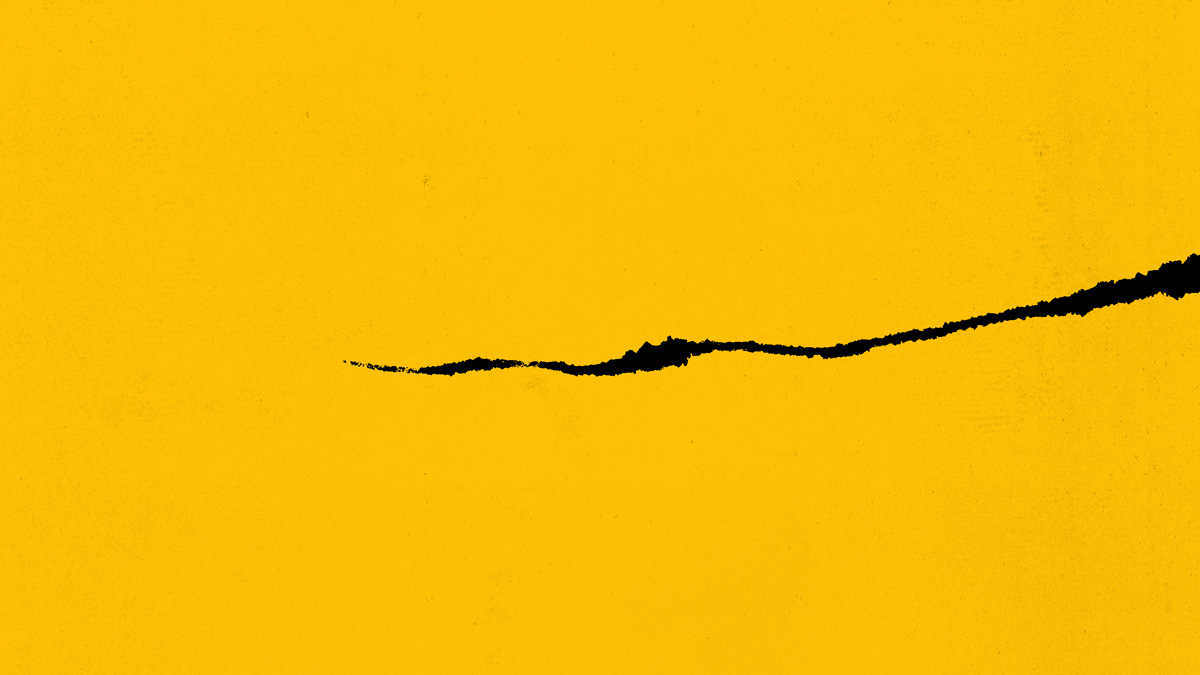
Noch vor einigen Monaten habe ich mir ausgemalt, wie ich nach der Pandemie meinen Freunden und Freundinnen in die Arme falle – zu lange konnten wir uns nicht nah sein. Ich habe mir vorgestellt, wie ich erleichtert und ohne Hemmungen in einer Menschenmenge in einem Konzertsaal stehe, wie ich beherzt an den Haltegriff in der S-Bahn greife, oder mit Freunden eine große Portion Pommes esse (ohne Besteck, alle mit den Fingern rein!). All das wird wieder erlaubt und möglich sein, es ist absehbar.
Aber der Punkt der Euphorie ist überschritten. Es gab einen Knacks. Die Leichtigkeit der Vorfreude ist weg. Das Unnormale dauerte zu lange an, ist normal geworden; ich habe mir das Unbehagen einverleibt. Selbst meine Impf-Begeisterung ist ob der Hektik und Ungeduld der Massen getrübt; es wird, neben der Erlösung, vor allem ein eiliges Gerangel um einen Termin bei irgendeiner Hausärztin im Nirgendwo sein. Woher das Narrativ eines magischen Rituals in meinem Kopf kam, das die Pandemie mit einem glanzvollen Feuerwerk für alle beenden würde, weiß ich nicht. Ich hatte wohl zu viel Zeit, es mir auszudenken.
Aber statt Feuerwerk gab es diesen Knacks, vor einigen Monaten schon. Krrck. Knack. Womöglich werde ich nie wieder eine Türklinke berühren. Immer einen Schritt zurück weichen wenn mich jemand anspricht. Immer Abstand halten wollen müssen. Manches davon ist okay, Händeschütteln können wir meinetwegen für immer sein lassen. Aber meine Freunde würde ich gerne ohne eine Schere im Kopf umarmen. Nach einem Jahr ist alles viel weiter voneinander entfernt – erst physisch, jetzt auch psychisch. Knacks, und wenn wir nicht aufpassen, treibt alles auseinander.
Auf mein Nacken

Zum Schreiben habe ich mir mein altes iBook reaktiviert. Es ist von 2003, läuft nur noch mit eingestecktem Netzteil, und das Internet funktioniert darauf nicht. Die Schreib-Experience ist nicht die beste, aber sie ist weitestgehend ablenkungsfrei. Das ist, was ich brauche, denn in den letzten Wochen (daher rührt auch mein versteifter Nacken) wirken die Bildschirme meines Smartphones und Tablets mehr als magnetisch auf mich. Sie paralysieren mich; stundenlang hänge ich mit dem Kopf im iPhone über der Küchenarbeitsplatte und scrolle durch Timelines, auch, wenn das Nudelwasser schon längst kocht. Es ist die Krankheit meiner Generation, unserer Zeit, aber es ist vor allem ein wirklich stark magnetisches schwarzes Loch, in das ich, gerade in der Pandemie, zu oft und zu gerne reinfalle. Vom Aufprall dann der steife Nacken.
Austin Kleon: Blogs als Forgiving Medium
Ich habe gestern etwas getwittert, und kurz darauf wieder gelöscht. Es war nichts Schlimmes; ein blöder Formfehler, der mich etwas dumm hätte dastehen lassen. Twitter als Medium hat mich da mit seiner fehlenden Editier-Funktion mal wieder schrecklich genervt. Kurz darauf stolperte ich über Austin Kleons Blogpost »Blogging as a forgiving medium«, und er spricht mir aus der Seele:
I am on Twitter, still, despite my better judgment, and it seems to me to be The extremely unforgiving medium in my life.
It is risky compositionally. You can delete a tweet, but you can’t edit a tweet. You can add to a tweet, but it’s hard to improve upon it.
It is risky socially. Every tweet is an invitation for scrutiny if not consultation if not correction if not misunderstanding if not rancor. Forgiveness, even if we agreed it still existed in the wider culture, I think we could probably agree it doesn’t really exist on Twitter. (“Never Tweet” is not terrible advice.)
Das Gleiche gilt für Instagram. Soziale Netzwerke mit ihren doch eher wenig verzeihenden Nutzer:innen und der nicht gebotenen Möglichkeit, Inhalte (bzw. Meinungen!) zu ändern oder wachsen zu lassen, werden immer uninteressanter für mich. Ich empfinde sie als unpassend für meine persönliche Meinungsbildung, und oft auch als kontraproduktiv für den allgemeinen Diskurs.
Blogs wiederum: Sie können sich ändern und wachsen, sie können ausführen oder weiterleiten, in die Tiefe gehen oder mehrere Gedanken miteinander vernetzen. Eine milde Form der Digital Gardens; ein forgiving medium, wie Kleon schreibt.
Das Christowski Blog wird diesen Monat 15 Jahre alt. Und wenn ich durch das Archiv hier stolpere, merke ich: Es ist, mehr noch als Notizbücher oder Skizzenblöcke, mein liebstes forgiving medium. Schön, dass ihr mitlest.
Im Eis

Mitten im Februar: Der Landwehrkanal ist zugefroren, und M. drängt darauf, dass wir uns für ein paar Schritte aufs Eis wagen. Es wird die letzte Chance sein; Klimawandel generell, und auch heute: in ein paar Stunden wird die Polizei hier alles abgeriegelt haben. Aber noch schlittern die Kreuzberger und Neuköllner hier auf dem Eis – jemand hat eine Boombox dabei; es gibt Menschen in Schlittschuhen und auf Skiern. Knallbunte Overalls; der Hipster lebt, she’s alive and well. Unter der Brücke: Ein toter Schwan, dramatisch auf dem Eis platziert. Leute haben Blumen drumherum gelegt. Und irgendwo hat jemand ein Loch ins Eis gehackt: vier, fünf Zentimeter, dicker ist das Eis nicht. Jeder Schritt knirscht, und wir klettern mutig/freudig/erregt zurück ans Ufer.
Nur ein paar Kilometer entfernt, im Treptower Karpfenteich, soll zeitgleich jemand unter dem Eis ertrunken sein. Auf Twitter sehe ich einen nackten Mann, der auf Schlittschuhen über das Eis rast und einbricht. Ich war noch nie ein Freund des Nervenkitzels, und Mut ist auch keine meiner ausgeprägteren Eigenschaften – aber zwischen Mut und Dummheit liegt ein schmaler Grad, dessen Exploration mir nicht lohnenswert scheint.
Stunden später laufen wir über die Hobrechtbrücke zurück nach Neukölln. Die Polizei hat, wie erwartet, den Kanal geräumt. Alles ist jetzt leer und das Eis hat seine Stille wieder. Der Schwan wird als letztes entfernt, er hinterlässt eine mit Blumen umrankte Silhouette. Auf der Brücke schauen Menschen auf sie herab.
Meine Erdbeernase
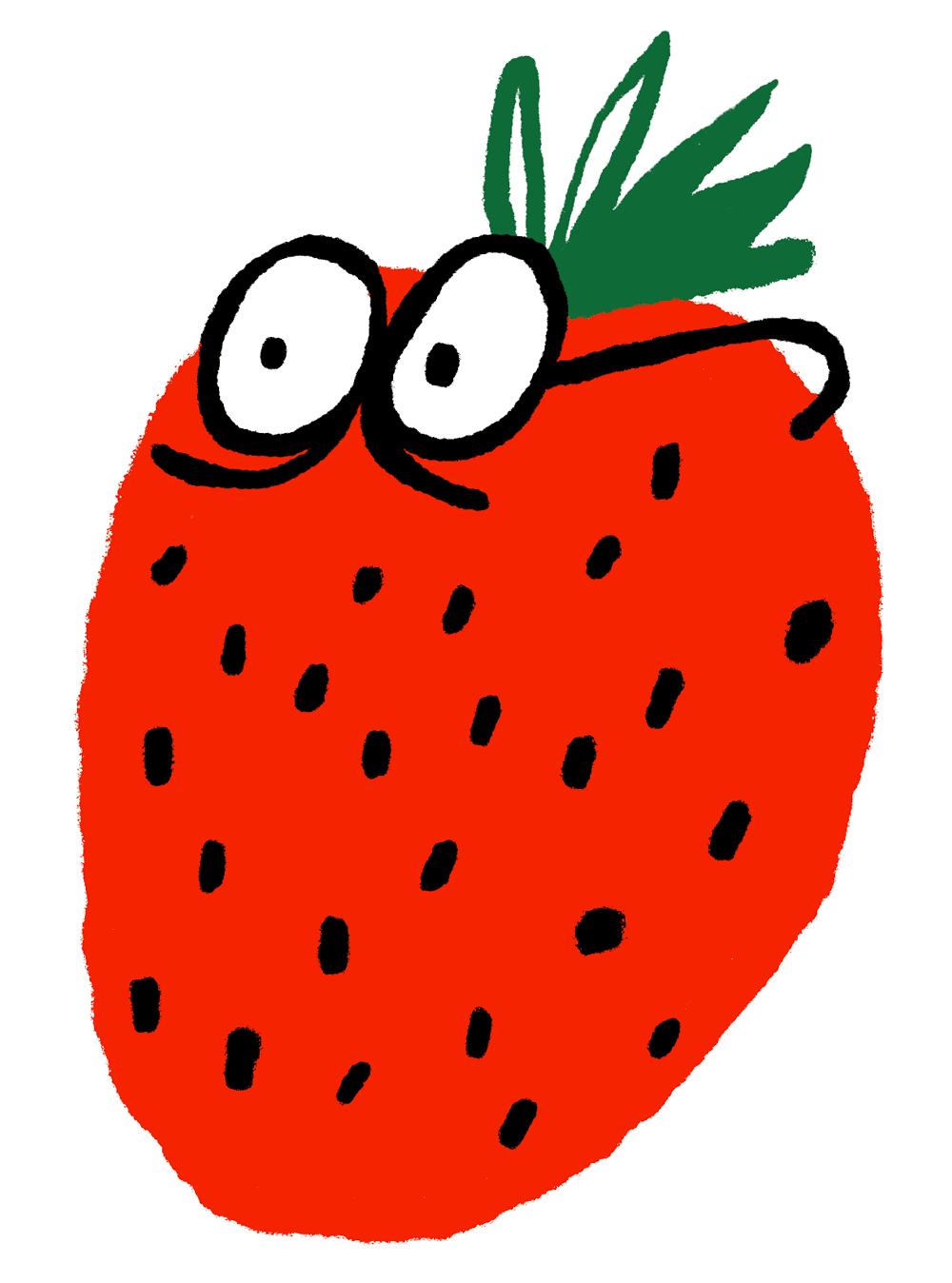
In letzter Zeit trinke ich Unmengen an Wasser, in der Hoffnung, davon wunderschöne Haut zu bekommen. Oft erschrecke ich, wenn ich in den Spiegel schaue. Nicht, weil ich mich so hässlich fände, sondern einfach, weil die Haut bei genauem Hinsehen mehr gezeichnet ist, als sie es mit 29 sein sollte. Meine Augenbrauen haben keine besonders markante oder männliche Ausprägung. Die große, kantige Nase ist fleckig und von tiefen Poren übersäht, wie eine Erdbeere. Sie leuchtet rot. Die Augen fallen nach innen, die Haut unter ihnen liegt da wie ein dunkler See. Ich sehe ständig müde aus (oft bin ich es auch, ehrlich gesagt).
Vor einer Weile habe ich mir bei Douglas Consealer gekauft, um gegen diese Augenringe anzukämpfen, aber es fühlt sich nicht richtig an; ich kann diese Müdigkeit nicht einfach übermalen und vergessen. Außerdem bin ich nicht sonderlich begabt, was Makeup angeht; ständig sieht man Konturen und Farbflecken und kleine Makeup-Partikel. Aus Verzweiflung trage ich ein spezielles Gel auf, das in Zukunft Falten um meine Augenwinkel vermeiden soll, aber als ich es A. anbiete, sagt er, er brauche das nicht, denn wenn es zu schlimm werde mit den Falten, lasse er sie sowieso mit Botox aufspritzen. Finde ich plausibel, werde ich auch so machen.
Auch die Idee, meine Nase korrigieren zu lassen, flammt wieder auf – ich finde, 30 ist ein gutes Alter, um das noch anzugehen; viel später wäre es vermutlich zu spät. Vielleicht fange ich an, ein wenig Geld dafür auf die Seite zu legen. Es wäre außerdem ein gutes Training, um davon abzukommen, ständig nur über die Meinung der anderen zu grübeln. Ich bin mir sicher, alle fänden mich schöner und begehrenswerter und seriöser, wenn ich nicht so eine riesige rote Erdbeernase hätte. Andererseits: Vielleicht reicht auch einfach ein Face Filter; Schönheit passiert ja sowieso hauptsächlich online heute. Den bräuchte ich dann aber auch noch für meinen Spiegel.